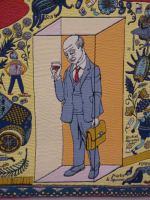Gemeinsinn und Eigensinn
Eine Studie zur Menschwerdung
Was hat den Menschen zum Menschen gemacht? Welche Rolle spielten dabei Egoismus bzw. Gemeinsinn? Und woher kommen die Werte und Ideale der "Humanität" ?
Im Vorwort ist nachzulesen, was mich zur Studie motivierte.
PDF-Dokument [130.5 KB]
In einer ZEITTAFEL habe ich die wichtigsten Epochen und Ereignisse zusammengestellt, die in der Studie thematisiert werden.
PDF-Dokument [117.9 KB]
Teil I: Der Mensch - ein Wir
Der Teil I der Studie „Der Mensch – ein Wir“ blickt zurück auf die Entstehungsgeschichte des Menschen im Verlauf der letzten 2,5 Mio. Jahre. Entscheidend war die besondere Ernährungsstrategie unserer frühen Vorfahren, die sich von der anderer Menschenaffen deutlich unterschied (vgl. auch die Seite "Menschwerdung"). Damit hängen nicht nur körperliche, sondern auch soziale, geistige und technologische Entwicklungen und Anpassungen zusammen, die typisch "menschlich" sind. Deutlich wird: Die Menschen haben nicht als "Einzelkämpfer" oder in lockeren Verbänden überlebt, sondern als Mitglieder eng kooperierender Gemeinschaften: also als ein "Wir".
Teil I der Studie umfasst ca. 80 Seiten.
PDF-Dokument [1.2 MB]
Zentrale Merkmale des Menschen (z. B. Sprache, Moral, Kunst, Religion, Werkzeuggebrauch, Erfindungsgeist, aber auch Besonderheiten der Aggressivität, Sexualität und Rangordnung) haben sich im Dienste der ursprünglichen Überlebensstrategie entwickelt. Das soll in den einzelnen Kapiteln (1. - 9.) deutlich werden.
PDF-Dokument [68.3 KB]
1. Kooperation bei der Nahrungssicherung und Nahrungsteilung
Das Erfolgsrezept unsere frühen Vorfahren war der gemeinsame, kooperative Nahrungserwerb durch Jagen und Sammeln, verbunden mit der geregelten Nahrungsteilung in der Gruppe. Je enger der Gruppenzusammenhalt, desto erfolgreicher war diese Strategie. Gemeinsames Teilen der Nahrung und anderer Ressourcen war selbstverständlich. Damit könnte auch der den Menschen auszeichnende Gerechtigkeitssinn zusammenhängen.
PDF-Dokument [268.0 KB]
2. Die menschliche Sprache - ein herausragendes Verständigungsmittel
Die Kommunikationsmöglichkeiten der menschlichen Sprache übersteigen die anderer Primaten bei weitem. Was ist das Besondere dieser Sprache? Und wann und wozu hat sie sich entwickelt? Sprache dient noch heute als „sozialer Kitt“, der das Zusammenleben auch in größeren Gemeinschaften ermöglicht.
Mit Sprache verbunden entstand ein weiteres Spezifikum des Menschen: sein Vorstellungsvermögen. Dieses schafft eine zweite Realität: die Welt der Erzählungen, der Mythen und der religiösen Vorstellungen. Sprache und sprachbasierte Kultur verbinden und trennen Menschengruppen.
PDF-Dokument [123.5 KB]
3. Empathie und Altruismus fundieren Gemeinsinn
Empathie und Altruismus sind wichtige Kennzeichen von „Menschlichkeit" (Humanität).
Empathie als die Einfühlung in die Stimmungslage und die Absichten (Intentionen) anderer stärkt den sozialen Zusammenhalt und fördert die Kooperation. Aber Menschen können auch auf erschreckende Weise völlig unempathisch reagieren. Wie kommt das ?
Empathie ist oft verbunden mit Altruismus (uneigennützigem, selbstlosem Handeln) und anderen moralischen Regeln (z. B. Tötungsverbot, friedliche Konfliktregulierung). Das gilt in allen menschlichen Sozietäten. Der Ursprung liegt aber nicht in der Religion und ihren Geboten, sondern im evolutioären Nutzen für die eigene Gemeinschaft.
PDF-Dokument [190.1 KB]
4. Rituale, Religion und Kunst waren wichtige Erfindungen für den Gruppenzusammenhalt
Nur Menschen kennen Religion, nur Menschen schaffen Kunst. Nur Menschen können sich mit der Endlichkeit der Existenz, also dem Tod, und den Unwägbarkeiten des Lebens auseinandersetzen.
Warum haben unsere Vorfahren irgendwann begonnen, gemeinsame Rituale zu entwickeln? Wie kamen sie zu religiösen Vorstellungen und welche Bedeutung hatten diese für das Überleben? Und wie entstand die Kunst bzw. das künstlerische Gestalten? Alle diese Entwicklungen hängen offenbar zusammen. Und auch sie stehen ursprünglich im Dienst der Überlebenssicherung
Meine These: Alle frühen Kunstobjekte sind Bestandteil von Kultzeremonien bzw. dienen als magische Zeichen. Sie sind Ausdruck einer Suche nach Schutz und Hilfe durch höherer Mächte bzw. sollen die jeweilige Gemeinschaft mit den Ahnen und dem kosmischen Ganzen verbinden..
PDF-Dokument [171.0 KB]
5. Aggressionsbereitschaft sichert das Überleben und den sozialen Zusammenhalt der Gruppe
Aggressivität im Dienst der Gemeinschaft? Sie soll die Gemeinschaft nach außen schützen und im Innern den Zusammenhalt sichern. Ein heikles Thema. Die Aggressionsbereitschaft gegen externe oder interne „Feinde“ ist ein archaisches Erbe, das bis heute virulent iist, vielfach politisch-ideologisch missbraucht wird und alle Bemühungen um universale Verständigung belastet.
PDF-Dokument [159.0 KB]
6. Sexualität – Ihre soziale Regulierung ist nötig für den Zusammenhalt der Gemeinschaft
Öffentliche Sexualität (wie bei Affen üblich) – das geht bei uns Menschen doch gar nicht! Aber warum? Die Sexualität hat (auch) beim Menschen einen ganz besonderen, weit über die biologische Fortpflanzungsfunktion hinausreichenden Stellenwert. Sie darf aber auf keinen Fall den kooperativen Zusammenhalt der Gemeinschaft stören. Wie die Sexualität in menschlichen Gemeinschaften reguliert wurde und wird, erläutert dieses Kapitel.
PDF-Dokument [164.3 KB]
7. Egalitäre Strukturen und Gemeineigentum festigen den Zusammenhalt
Territorialität und Rangordnung gibt es bei fast allen Primaten (Affen und Menschenaffen). Im Zuge der Menschwerdung und der Entwicklung von Kooperationsgemeinschaften sind aber bei unseren frühen Vorfahren soziale Hierarchie bzw. Rangordnung zunächst abgebaut und durch eher egalitäre Strukturen ersetzt worden. Dennoch prägen uns bis heute beide Tendenzen: egalitäres Zusammenleben oder eine Rückkehr zu strikter Hierarchie, Gemeinsinnorientierung oder Entfaltung des (egoistischen) Eigensinns bzw Individualismus.
PDF-Dokument [114.7 KB]
8. Werkzeuge und technologische Innovationen sichern das Überleben
Planmäßige Werkzeugherstellung und differenzierter Werkzeuggebrauch sind ganz zentrale Merkmale des Menschen. Sie setzen eine hohe Lernfähigkeit bzw. Intelligenz voraus.
Werkzeuge sind immer auch Waffen für die Jagd oder für den Kampf gewesen; sie waren und sind ein wichtiges Element der Überlebenssicherung. Entsprechend sorgfältig erfolgte i. d. R. ihre Herstellung, die von unseren Vorfahren zudem fast immer mit magischen Kraftzeichen verbunden wurde.
Lange war der technologische Fortschritt minimal, dann kam es im Eiszeitalter zu erstaunlichen Entwicklungssprüngen (vgl. auch den Text "Menschwerdung" - Kap. 3 und 4).
PDF-Dokument [95.0 KB]
9. Herausragende Lern- und Anpassungsfähigkeiten als Erfolgsrezept
Die außerordentliche Lernfähigkeit und Intelligenz ist ein herausragendes Merkmal des Menschen. Menschliches Lernen ist in hohem Maße interaktiv, also sozial vermittelt. Beim Homo sapiens findet zudem eine rascher Austausch von Innovationen statt.
Mit der Lernfähigkeit zusammen hängt die ganz außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Menschen (insbesondere des Homo sapiens) an wechselnde Umwelt- und Ernährungsbedingungen und sonstige Lebensumstände (vgl. Text Menschwerdung Kap 4).
PDF-Dokument [128.5 KB]
PDF-Dokument [54.6 KB]
Vieles von dem, was wir heute unter "Humanität" verstehen, hat sich evolutionsbiologisch als vorteilhaft im Überlebenskampf der einzelnen Horden oder Sozietäten entwickelt. Leider immer nur im Dienste der jeweiligen ethnischen Gemeinschaft und noch ganz ohne universellen Anspruch.
Teil II: Vom Wir zum Ich
Der Teil II der Studie „Vom Wir zum Ich“ beschreibt die dramatischen Umbrüche, die zu einer Auflösung der durch Gemeinsinn geprägten archaischen Gemeinschaften führen.
Blickt man auf die 2,5 – 3 Mio. Jahre alte Menschheitsgeschichte der Gattung Homo, ist dieser Wandel ganz neu und jung, zugleich aber tiefgreifend und unumkehrbar. Damit verbunden sind u.a. drei wesentliche gesellschaftliche Entwicklungen::
- Von egalitären Strukturen zu Herrschaftsverhältnissen
- Von der Gemeinsinnorientierung („Wir-Gefühl“) zum Individualismus
- Von der ethnozentrischen zur universalistischen Perspektive.
In den folgenden Abschnitten skizziere ich einige zentrale historische Umbruchphasen:
1. Der Übergang zu Ackerbau und Viehzucht (Sesshaftwerdung)
2. Die Entstehung der sog. Zivilisationen (Stadtkulturen)
3. Wegbereiter der europäischen Moderne in der: Antike und im Mittelalter
4. Die Entwicklung der Moderne und des „westlichen Individualismus" (Bürgertum, Renaissance, moderne Wissenschaft, Kolonialismus u.a.)
5. Die zweite Phase der Moderne, verbunden mit Aufklärung, industrieller Revolution, Kapitalismus und Imperialismus sowie den sozialen Bewegungen Sozialismus, Nationalismus, Faschismus.
6. Abschließend ein kurzer Blick auf die derzeitige Digitalisierung und Automatisierung.
Die sechs Kapitel - auch sie können für sich gelesen werden - werden im Folgenden in Kurzform und als pdf-Dokument vorgestellt. Insgesamt umfasst Teil II 180 Seiten.
Der gesamte Teil II kann als Buch bestellt werden.
PDF-Dokument [57.5 KB]
PDF-Dokument [2.5 MB]
PDF-Dokument [102.0 KB]
1. Neolithische Revolution: Eine neue Lebensweise - mit Folgen!
Auch nachdem viele Menschengruppen zu Ackerbau und Viehzucht übergehen, bleibt die ursprüngliche Gemeinsinnorientierung noch lange bestehen. Kulte gewinnen nun einen enorme Bedeutung für die Existenzsicherung und sind ein zentrales Element im Zusammenleben.
Mit steigender Bevölkerungszahl, der Erzeugung erheblicher Überschüsse in der Bewässerungsfeldkultur und der Möglichkeit Arbeitsteilung einzuführen, entstehen Voraussetzungen für soziale Ungleichheit. Herrschaft entsteht aus den aufwändigen Kulten - oder über kriegerische Eroberung (vgl. auch die Datei über die Entstehung von Herrschaft in Teil IIi)
PDF-Dokument [426.4 KB]
2. Zivilisationen: Gottgleiche Herrscher, Klassengesellschaft und Patriarchat
Der große Umbruch von eher egalitären Dorfgemeinschaften zu Zivilisationen (Stadtgesellschaften) vollzieht sich innerhalb erstaunlich kurzer Zeit überall dort, wo regelmäßig erhebliche Überschüsse produziert werden.
Die ursprünglichen egalitären Gemeinschaften bestehen nicht mehr, stattdessen werden extreme Formen von Hierarchisierung etabliert: Klassengesellschaften mit gottgleichen Herrschern (meist Männern) an der Spitze. Unglaublich aufwändige religiöse Kulte sichern die Produktion und die Herrschaft.
Zusätzlich werden repressive Systeme (Militär-, Polizei- und Justizwesen) mit aus heutiger Sicht barbarischen Strafen eingeführt. Die Militarisierung der Gesellschaft geht mit einer zunehmenden Dominanz der Männer einher. Kriege sind die Pfeiler aller antiken Zivilisationen, eine männliche Elite die Hauptprofiteure.
Alle zivilisatorischen Errungenschaften und Neuerungen werden auf die eine oder andere Weise in diesen Prozess der Absicherung gottgegebener Herrschaft und der Ausweitung staatlicher Macht eingebunden. Die traditionelle Gemeinsinnorientierung wird immer weiter ausgehöhlt: durch Einführung des privaten Eigentums, des Kredit- und Geldwesens, der Schrift und Zahlenssteme.
PDF-Dokument [567.9 KB]
3. Wegbereiter der Moderne
Im ersten Jahrtausend vor Christus entstehen in einigen Kulturkreisen rationalistische, humanistische und universalistische Ideen und damit ein neues „Menschenbild“, das bereits auf die sog. Moderne verweist.
Der jüdisch-christliche und der griechisch-römische Kulturraum spielen dabei eine besondere Rolle - zumindest aus heutiger (eurozentrischer) Perspektive.
Im antiken Judentum und im frühen Christentum entstehen Ansätze einer universalistischen Ethik und Moral.
In der griechischen Philosophie und Polis setzt sich in der Antike einer neuer Rationalismus gegen alle mythisch-magischen Traditionen durch, der universalistische Prinzipien und die Idee der Gleichwertigkeit aller Menschen formuliert.
Altruistische Werte und Empathie (Nächstenliebe) sowie die Ideen der Gleichheit und sozialen Gerechtigkeit werden im sog. Westen im Verlauf des europäischen Mittelalters wiederbelebt.Sie verbinden sich mit neuen Ansprüchen auf individuelle Freiheit und Partizipation und mit einer rationalen Weltsicht.
PDF-Dokument [409.3 KB]
4. Die Moderne: Der neue Individualismus des "Westens"
Im westlichen Europa (Abendland) kommt es zu einer globalen Sonderentwicklung. Nur hier tritt mit dem städtischen Bürgertum im Hoch- und Spätmittelalter eine gesellschaftliche Klasse hervor, die einen neuen Individualismus repräsentiert.
Mit der Renaissance (etwa ab 1450 n. Chr.) und/oder mit der „wissenschaftlichen Revolution“ (etwa ab 1600 n. Chr.) treten vermehrt selbstbewusste, kreative, wissbegierige, entdeckungsfreudige Menschen hervor, die auch den Konflikt mit Autoritäten nicht scheuen.
Im Zuge der Reformation kommt es im westlichen Europa einerseits zu einem Rückzug in Innerlichkeit und Gewissensprüfung (Luthertum), andererseits zu einem verstärkten Streben nach beruflichem Erfolg durch Fleiß, Selbstdisziplin und rationales Nutzenkalkül (Calvinismus, Puritanismus). Die Eroberung und Kolonialisierung der Welt beginnt.
Die Folgen dieser Entwicklungen zeigen sich iin vielfältigen Formen: Ich-Bezogenheit, Fortschrittsglaube, Leistungsdenken, Rationalität und Gefühlskontrolle sowie in einem rassistischen Herrenmenschentum.
PDF-Dokument [484.4 KB]
5. Das Individuum zwischen Aufklärung und Kapitalismus
Aufklärung, industrielle Revolution, Kapitalismus und Imperialismus kennzeichnen dramatische Veränderungen der Lebensverhältnisse weltweit. Sie haben im sog. Westen das Individuum aus traditionellen Bindungen und Zwängen gelöst und auch weltweit traditionelle Ordnungen zerstört.
Mit der Aufklärung finden Ideen und Ideale Verbreitung, die heute zum Allgemeingut der Menschheit gehören: Menschenrechte, Recht auf Selbstbestimmung, friedliche Konfliktlösung, religiöse Toleranz usw. Das zielt auch auf eine universale Gemeinsinnorientierung.
Mit der industriellen Revolution beginnt der globale Siegeszug des Kapitalismus. Dieser fordert und fördert zweckrationales Denken und Handeln, individuelle Vorteilssuche und Nutzenoptimierung und damit auch individuelles Leistungs- und Konkurrenzdenken. Eigensinn in seiner kalten Form, als rücksichtsloser Egoismus, als suchtartiges Streben nach Gewinn und die globale Entfaltung des modernen Kapitalismus gehen Hand in Hand.
Gemeinschaftsangebote und -surrogate und religiös-ideologische Sinnversprechen bleiben aber bedeutsam. Der „westliche“ Individualismus sieht sich mit neuen Gemeinschaftserfahrungen und Gemeinsinn-Ideologien konfrontiert: Sozialismus bzw. Kommunismus sowie Nationalismus bzw. Faschismus.
PDF-Dokument [773.0 KB]
6. Die digitale Revolution
Die Neuentwicklungen im Bereich digitalen bzw. elektronischen Datenverarbeitung (Computer – Internet – digitale Medien) führen seit Ende des 20. Jhds. zu den vielleicht folgenreichsten Veränderungen im Leben und Wirtschaften der Menschen seit der industriellen Revolution. Die Dynamik des Wandels ist rasant, die weiteren Entwicklungen kaum absehbar.
Ich kann hier nur auf wenige Aspekte dieser Entwicklungen eingehen – vor allem im Hinblick auf die möglichen Folgen für Individualität und des Gemeinsinn. Thematisiert (skizziert) werden:
- Computersteuerung der Wirtschaft (Industrie 4.0) – Das Ende der Arbeit?
- Die Technologisierung des Alltags - Ein Rationalitätschub?
- Globale Kommunikation: Neue Möglichkeiten der medialen Zugehörigkeit, Partizipation und Selbstdarstellung
- Die Roboterisierung des Menschen - Das Ende des Individuums?.
PDF-Dokument [354.8 KB]
Teil III: Gemeinsinn und Eigensinn: Paradoxien der Moderne
Der Mensch ist ursprünglich ein Wir. Nur durch enge Kooperation und Gemeinsinnorientierung haben die kleinen Gemeinschaften des Homo sapiens überleben und sich ausbreiten können (vgl. Teil I). Der Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit, Gemeinschaft und Gemeinsinn ist menschheitsgeschichtlich tief verankert und auch heute noch sehr ausgeprägt und verbreitet.
Mehrere historische Umbrüche (vgl. Teil II) haben dazu geführt, dass der ursprüngliche Gemeinsinn sich auflöst und nun Eigensinn eine immer größere Bedeutung erfährt: als Streben nach individuellem Erfolg, nach Macht und Reichtum, aber auch nach persönlicher Freiheit und persönlichem Glück. Die Spannung zwischen Gemeinsinn und Eigensinn führt heute zu vielfältigen gesellschaftlichen und persönlichen Konflikten und Widersprüchen. Einige sollen hier thematisiert werden.
- Herrschaft: Wunsch nach individueller Partizipation versus Hoffnung auf (gottgesandte) mächtige Führer
- Individualisierung: Wunsch nach Selbstinszenierung versus Wunsch nach verlässliche Einbindung in eine soziale Gemeinschaft
- Universalisierung: Weltoffenheit und Weltgemeinschaft versus partikulare Abgrenzung.
Angesichts der Komplexität der Fragestellungen werden in diesem Teil der Studie nur Einzelaspekte thematisiert.
PDF-Dokument [66.4 KB]
1. Hierarchie und Herrschaft: Autoritäre Führung oder demokratische Selbstbestimmung und Gleichberechtigung
Wie sind politische Herrschaft und soziale Ungleichheit bzw. Ungerechtigkeit in der Menschheitsgeschichte entstanden? - Ich stelle hier noch einmal meine „K+K-Hypothese" vor und versuche dabei zu erläutern, wieso die über lange Zeiten egalitär strukturierten Gemeinschaften schließlich absolutistische Formen der Herrschaft durch „gottgesandte Führer" akzeptieren. Ich versuche aber auch zu zeigen, wo und wie Gleichheits- und Gerechtigkeitsideale bzw. die Ideen der Demokratie und Volkssouveränität überdauern und wiederbelebt werden konnten.
Heute konkurrieren Konzepte einer von gleichberechtigten Bürgerinnen und Bürgern mitgestalteten und legitimierten Herrschaft (freiheitlich-demokratische Gesellschaften) mit autokratischen Formen, in denen sich selbst ermächtigende (gottgesandte?) Führer die Geschicke der Gesellschaft oder Nation in die Hand nehmen.
PDF-Dokument [335.7 KB]
PDF-Dokument [341.7 KB]
2. Individualisierung: Zwischen Freiheits- und Gemeinschaftssuche
In der Menschheitsgeschichte tritt vielerorts der oder die Einzelne immer stärker hervor. Das führt zu neuen Spannungen zwischen individuellen und gesellschaftlichen Ansprüchen und Anforderungen.
Der moderne Individualismus zeigt sich zerrissen zwischen dem Wunsch nach „Selbstverwirklichung" und der Suche nach dem verlässlichen „Wir", einem Wunsch nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Einsamkeit und Sinnkrisen sind Massenphänomene, ebenso wie Selbstinszenierungen, der Wunsch nach Beachtung und Anerkennung sowie nach sinnvollen Aufgaben in und für eine Gemeinschaft.
Es ist die Frage, ob und wie sich die Wünsche nach „individueller Freiheit" und „sozialer Zugehörigkeit" verbinden lassen - ohne Rückgriff auf aggressive oder gewaltsame Formen der Ab- und Ausgrenzung.
(Alte Beiträge dazu haben ich wieder gestrichen. Aktuell keine neuen Beiträge)
3. Universalisierung: Weltoffenheit und neue Abgrenzungen
Die Entstehungsgeschichte der Menschheit ist auch die Geschichte der Ausweitung der ursprünglich engen ethnozentrischen Horizonte und der Ausbreitung universalistischer Ideen (Idee der einen Menschheit und der individuellen Menschenrechte). Einerseits leben immer mehr Menschen heute in anonymen Massengesellschaften und in globalen Vernetzungszusammenhängen, andererseits ist der Homo sapiens ursprünglich auf ein Leben in kleinen überschaubaren (personalisierten) Gemeinschaften "geprägt".
Das führt auch zu einem Konflikt zwischen den Ideen und Leitbildern der Weltoffenheit und individuellen Freiheit einerseits und separatistischen Wir-Ideologien (Nation, Volk, Religion) andererseits.
Kann sich die universalistische Idee und Vision einer Gemeinschaft der Menschheit gegenüber ethnozentrischen oder anderen separatistischen Neigungen und Tendenzen durchsetzen? Oder bleiben die Ideale der allgemeinen Menschenrechte und der Demokratie letztlich ein Konzept des „Westens"? Autoritär-nationalistische Tendenzen nehmen zu. Geraten die Demokratien wieder in die Defensive?
Zu diesen Fragen präsentiere ich vorerst zwei Texte. Der zweite ist ein Auszug aus dem Essay "Die westliche Moderne und das Unheil in dieser Welt".
PDF-Dokument [327.1 KB]
PDF-Dokument [294.5 KB]
Teil IV: Freiheit oder Gerechtigkeit?
Ich werfe nun einen Blick auf einige neuere philosophische Denkansätze. Dabei beziehe ich mich fast ausschließlich auf Sekundärliteratur. Im Mittelpunkt des (eklektizistsichen) Vorgehens steht die Frage, ob und wie in unserer Zeit die Ansprüche sowohl auf individuelle Freiheit als auch auf soziale Gerechtigkeit versöhnt werden können.
Befragt werden:
1. Der US-amerikanische Philosoph John Rawls: Freiheit und Gerechtigkeit verbinden
2. Der Kommunitarismus (Michael Walzer, Charles Taylor): Leben in Gemeinschaften
3.Der US-amerikanische Philosoph Richard Rorty: Empathieförderung für eine solidarische Gemeinschaft
4. Der Utilitarismus (Jeremy Bentham, Peter Singer): Das Wohlergehen aller als Ziel
5.Arthur Schopenhauer: Egoismus und Sinnlosigkeit durch eine Ethik des Mitleids überwinden
6.Friedrich Nietzsche: Amoralische Lebenskraft und Übermenschentum
7.Der Existenzialismus (Jean Paul Sartre, Albert Camus: Individuelle Freiheit und tätiges Leben im Lichte der Sinnlosigkeit
8.Der Konstruktivismus: Individuelle Wirklichkeiten als Quelle von Missverständnissen
Ggf. folgen noch weitere "Befragungen".
Teil IV umfasst derzeit 45 Seiten (Stand: Ende 2019).
PDF-Dokument [675.6 KB]
Ergänzend noch zwei aktuellere Texte zu John Rawls Theorie der Gerechtigkeit.
PDF-Dokument [153.5 KB]
PDF-Dokument [186.8 KB]
[